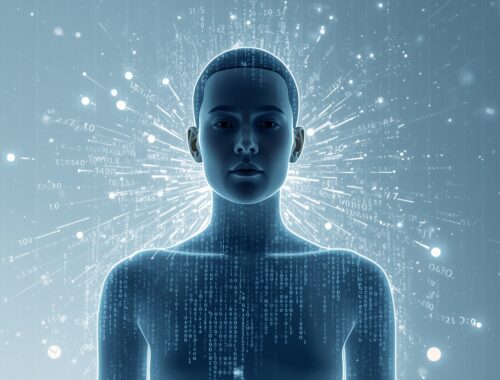Wir brauchen den Crash der KI-Blase

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass wir eine Schlagzeile in den Wirtschaftsteilen der Medien zu Gesicht bekommen, die sich mit der KI-Blase beschäftigt. Die Diskussion dreht sich um drei Fragen: Gibt es die Blase überhaupt? Oder erleben wir berechtigte Euphorie vor einem gigantischen Wachstum? Und falls die Blase existiert: Wann platzt sie?
An den Börsen werden Wetten abgeschlossen auf eine rosige Zukunft mit einer allwissenden und allumfassenden KI. Andere wetten dagegen und sagen voraus, dass die Blase in den kommenden Monaten platzen muss, weil die Situation so sehr der Dotcom-Blase ähnelt.
Schaut man sich die Bewertungen für Unternehmen wie Palantir, Nvidia, Cloudflare oder Crowdstrike und deren Ebitda an, so muss man sich wirklich fragen, wo die wirtschaftliche Grundlage für deren Marktkapitalisierung ist.
Betrachtet man das Investitionsvolumen in KI im laufenden Jahr der Top-Tech-Konzerne (Microsoft, Oracle, Apple, Amazon, Meta, Alphabet) von rund 405 Milliarden US-Dollar sowie die angekündigten Investitionen für die kommenden Jahre, bleibt fraglich, wie diese Summen wieder erwirtschaftet werden sollen. Ganz zu schweigen von Unternehmen wie OpenAI, die hunderte von Milliarden investieren wollen, aber bislang kein schlüssiges Konzept vorgelegt haben, wie sie dieses Geld wieder verdienen wollen.
Bei globaler Betrachtung ist deutlich darüber hinaus zu erkennen, dass in den Ländern, die früher als Motoren der Weltwirtschaft galten, die Wirtschaft derzeit stockt oder sich im Abwärtstrend bewegt:
China: Export-Abhängigkeit als Achillesferse
China erlebt zum ersten Mal seit seinem Aufstieg zur Wirtschaftsmacht, dass seine Abhängigkeit vom Export, der lange Zeit das Wirtschaftswachstum vorangetrieben hat, auch negative Folgen haben kann. Die Zeichen sind unübersehbar: Die restriktive Zollpolitik der Amerikaner ist dabei nur einer der Faktoren.
Das Land hat sich im vergangenen Jahrzehnt in eine starke Abhängigkeit vom Export manövriert und forciert das auch heute noch. Inzwischen allerdings nicht mehr nur mit Billiglohn-Produkten aus dem Textil- oder Elektroniksektor, sondern fortschreitend auch mit High-Tech, Autos, hochwertigen Luxusartikeln, Robotik und KI.
Doch wenn die Nachfrage im Ausland zurückgeht, stockt die einheimische Wirtschaft. Abgesehen von vielen prestigeträchtigen Großprojekten hat man viel zu wenig getan, um den Inlandskonsum zu fördern. Das versucht man gerade zu korrigieren. Die Immobilienkrise, die mit dem Zusammenbruch von Branchenriesen wie Evergrande sichtbar wurde, hat bereits Billionen an Vermögenswerten vernichtet. Die heimische Immobilienkrise und die Tatsache, dass große Teile der Bevölkerung von der technologischen Entwicklung des Landes immer noch abgekoppelt sind, hängen wie ein Damoklesschwert über dem Reich der Mitte und werden im Falle einer Weltwirtschaftskrise zu einem massiven Problem werden.
USA: Stillstand trotz KI-Hype
Betrachtet man die amerikanische Wirtschaftslage losgelöst vom derzeitigen KI-Hype und den zirkulären KI-Chip und Rechenleistungs-Deals der vergangenen Wochen durch OpenAI, Nvidia, Oracle und andere, wird klar ersichtlich, dass die amerikanische Wirtschaft auf der Stelle tritt. Mit weiterer Zunahme der irrationalen Aktionen des amerikanischen Präsidenten wird sich die Schieflage der Märkte in Nordamerika noch verschlimmern.
Im Falle einer Weltwirtschaftskrise muss man davon ausgehen, dass die USA keine Stütze bestehender Strukturen sein werden. Die amerikanische Regierung und allen voran Donald Trump werden nicht einen Moment zögern Jahrzehnte bestehende strategische Allianzen zum eigenen Vorteil oder dem des eigenen Landes aufzugeben.
Von Anfang seiner Amtszeit an steht der Vorwurf der Vetternwirtschaft im Raum. Kritiker werfen ihm auch unverhohlenen Bemühungen vor sich permanent selbst zu bereichern und zu beweihräuchern.
Angesichts seiner erratischen Fiskal-, Finanz- und Wirtschaftspolitik muss man im Falle einer Weltwirtschaftskrise davon ausgehen, dass die USA eine Weltwirtschaftskrise eher noch anfeuern als sie in einer konzertierten Aktion zu verhindern. Die Amerikaner werden nicht daran interessiert sein im Sinne einer schnellen Stabilisierung der Märkte Kompromisse einzugehen, die ihre markt- und währungspolitische Macht schmälern würden.
Deutschland und Europa: Strukturelle Lähmung
In Deutschland schwächelt die Wirtschaft schon seit geraumer Zeit. Arbeitsplätze werden abgebaut, Industrien wandern ab oder verlagern Teile der Produktion ins Ausland. Der Export lahmt. Es mangelt an Innovationskraft, mutigen Investitionen, Fachkräften und Infrastruktur.
Künstliche Intelligenz löst das Internet als neues Vehikel der industriellen Erneuerung ab. Und die Deutschen diskutieren immer noch darüber wie wir in Zukunft unseren Strom produzieren und in welchem Jahrzehnt wir mit dem Ausbau des schnellen Internets fertig sein werden.
Nur zur Erinnerung: Das Thema Strom steht seit weit über hundert Jahren auf der Agenda. Der Glasfaserausbau für schnelles Internet begann bereits in den späten Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts – und kommt immer noch schleppend voran.
Und unsere europäischen Nachbarn schwächeln ebenfalls. Europa ist innerhalb nur weniger Jahre so schwach geworden wie niemals zuvor in seiner Geschichte. Die EU ist angesichts wirtschaftlicher, politischer und kriegerischer Herausforderungen erkennbar überfordert. Es zeigt sich, dass die EU im Laufe der Jahre weniger zu einer politischen und wirtschaftlichen Allianz zusammengewachsen ist, sondern vielmehr zu einem Verwaltungsapparat geworden ist. Dieser arbeitet ineffektiv, behäbig und wird von Interessenvertretern großer Unternehmen und Verbänden in engen Bahnen gelenkt, die Innovationen und das Wohl der Bevölkerung mehr behindern als fördern.
Der politische Konsens ist auf ein Minimum geschrumpft. Viele Mitgliedsländer haben mit den eigenen Problemen so viel zu tun, dass man die gemeinschaftlichen Ziele hintenanstellt. Frankreich hat smit einer Schuldenquote von über 110% des BIP soo hohe Staatsschulden, dass es sie kaum noch schultern kann. In Italien verhindert Meloni tiefgreifende Reformen in Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Und in einigen anderen Nachbarstaaten machen Grabenkämpfe zwischen linken und rechten Strömungen eine konstruktive Regierungsarbeit und eine europäische Zusammenarbeit zunehmend schwerer. Das zeigte sich in jüngster Vergangenheit am Scheitern des Migrationspaktes sowie den schwierigen Verhandlungen zu den Ukraine-Hilfen.
Das globale Pulverfass
Alles in allem steht die Weltwirtschaft nicht sehr gut da. Und vor allem die Schwäche der USA und die unvorhersehbaren Machtspielchen von Präsident Trump machen die Amerikaner mit der Leitwährung US-Dollar zu einem Pulverfass, das, wenn es explodiert alles mit sich in den Abgrund reißen wird.
Die Börsen erleben Höhenflug um Höhenflug. Das ist wirklich erstaunlich, wenn man die realen Daten betrachtet. Die Staatsfinanzen im Keller, die Wirtschaften der G20 im Stillstand, politische Brandherde überall. Und die Unternehmensdaten, der Top-KI-Unternehmen rechtfertigen die aktuellen Bewertungen nicht ansatzweise
Die Kurse der größten amerikanischen Tech-Unternehmen entbehren sämtlich einer realistischen Bewertung aufgrund ihrer Erträge oder erwartbarer Ergebnisse in den kommenden Jahren. Selbst bei den Unternehmen, die wirtschaftlich solide dastehen, finanziell potent sind und über umfangreiche regelmäßige Einnahmen verfügen wie Amazon, Google oder Meta, ist anzunehmen, dass sich die Investitionen, die derzeit im Bereich KI getätigt werden, auch auf Sicht von 10 Jahren nicht amortisieren werden.
Dadurch werden auch die Bewertungen für Unternehmen außerhalb des Sektors beeinflusst und hier entwickelt sich eine Reihe kleinerer Blasen, die im Strudel des Platzens der KI-Blase sicherlich ebenfalls der allgemeinen Kurskorrektur zum Opfer fallen dürften.
Erschreckend dabei ist, wie die großen Zampanos der Tech-Unternehmen Altman, Musk und Bezos immer wieder neue Milliardendeals oder Investitionen ankündigen und im nächsten Atemzug mittlerweile sämtlich vor einer drastischen Marktkorrektur warnen. So etwas nenne ich Geld verbrennen mit Ansage.
Die zirkulären KI-Chip-Deals pusten viel heiße Luft in eine Blase, die bereits zuvor deutlich erkennbar war. Jetzt ist sie zum Bersten gefüllt und droht jeden Moment zu platzen.
Die Krise kommt – und keiner will gegensteuern
Es steht zu erwarten, dass dies weltweite Folgen haben wird. Meiner Meinung nach müssen wir uns auf eine Weltwirtschaftskrise innerhalb der kommenden 6 Monate vorbereiten. Die großen Tech-Unternehmen werden nichts tun, um dies zu verhindern.
Die amerikanische Regierung unter einem destruktiven Präsidenten Trump mit seiner America First-Politik wird die Entwicklungen noch anfeuern. Seine ständigen Provokationen, seine Zollpolitik und seine Angewohnheit alles, was als beschlossen und vereinbart gilt, nach wenigen Wochen wieder in Frage zu stellen, machen ihn zu einem Risikopartner. Wobei vermutlich immer weniger Partner ihn im Laufe der Zeit tatsächlich als Partner bezeichnen werden. Eher als ein notwendiges Übel.
Andere politische Führungsfiguren sind weit und breit nicht sichtbar. Die Chinesen verkriechen sich in ihr riesiges Schneckenhaus und verfolgen weiter ihre eigene Agenda hinter verschlossenen Türen. Die EU ist finanziell schwach und zerstritten. Anderen Ländern oder deren politischen Köpfen kann man wohl kaum eine Führungsrolle im Falle einer weltweiten Wirtschaftskrise zutrauen.
Wenn also weder die großen Tech-Player noch die Regierungen der wichtigsten Wirtschaftsnationen dem ganzen Spiel Einhalt gebieten werden, wer könnte es dann? Die Banken? Die Investoren? Wohl kaum!
Das Spiel der Finanzjongleure
Die Banken spielen das gleiche Spiel wie während der Dotcom-Blase oder der Finanzkrise im Jahr 2008. Hinzu kommen neue Player im Spiel mit Milliarden, sogenannte Schattenbanken. Diese Institutionen, wie Hedge-Fonds, Private-Equity-Firmen und andere kaum regulierbare Finanzakteure, die Geld am Kapitalmarkt einsammeln, unterliegen nicht den gleichen Spielregeln und damit auch nicht den noch geltenden Beschränkungen für die Banken.
Risikobewertungen werden nebensächlich, Ratings für Finanzanlagen manipuliert, und die Anleger haben nur noch die Dollarzeichen in den Augen. Zum wiederholten Male haben wir es hier mit einem riesigen Roulette zu tun, an dem die mächtigen Finanzjongleure aus aller Welt Platz genommen haben. Die Banken und Schattenbanken organisieren das Spiel, sie halten die Kugel am Laufen, sie verteilen die Gewinne und sie streichen einen Großteil des Geldes ein.
Und die Investoren? Die meisten derjenigen, die mit Millionen oder Milliarden in diesem Spiel engagiert sind, interessiert es nicht, wenn sie morgen ein paar Millionen oder Milliarden verlieren. Sie sind an der Spielbank beteiligt. Wer draufzahlt, das ist die Mittelschicht, die, um im Bild zu bleiben, nachdem sie alles verzockt hat mit leeren Taschen aus dem Spielkasino abzieht. Vorbei an denen, die gar nicht erst mitspielen dürfen. Die armen Schlucker, die sich nicht mal den Eintritt ins Spielkasino leisten können, und beim Spiel nur zuzuschauen.
Soweit zum Status Quo. Nun lautet die Überschrift dieses Artikels aber „Wir brauchen den Crash…“.
Wie das?
Tatsächlich wird viel über die Wahrscheinlichkeit des Platzens der Blase spekuliert und über Sinn und Unsinn, der unglaublichen Investitionssummen, die da im Raume stehen. Und falls jemand spekuliert, was die Folgen sein könnten, so hört man in erster Linie von den KI-Enthusiaten und Befürwortern, die eine Zukunft ohne Krankheiten, ohne Arbeit und mit Wohlstand für alle prognostizieren.
Worüber man kaum etwas hört ist, was passiert, wenn die Blase tatsächlich platzt. Vielleicht, weil wir aus der Vergangenheit bereits Erfahrungswerte haben. Vielleicht, weil das was uns erwartet, wenn die Blase platzt für viele sehr unschön werden könnte. Vielleicht, weil niemand, wirklich niemand den Crash will, abgesehen von den paar Spekulanten, die ihre Put-Optionen im Portfolio haben. Vielleicht, weil sich niemand vorstellen kann, dass Schmerz auch heilsam sein kann.
Der Crash als notwendiges Korrektiv
Aber gehen wir zunächst einmal ganz logisch und analytisch an die Sache heran. Ein Crash ist eine natürliche Reaktion auf eine Überhitzung der Märkte. Er kann ein notwendiges Korrektiv sein, durch das überbewertete Vermögensblasen bereinigt werden.
Wenn Angebot und Nachfrage aus dem Ruder laufen, weil irrationales Wunschdenken und träumerische Erfolgsvisionen gepaart mit ungezügelter Wettlust die Aktionen auf dem Börsenparkett steuern, kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem die Kurve einknickt. Das ist der Verlauf eines jeden Börsenkurses auf lange Sicht. Es geht niemals nur bergauf. Jeder weiß es, jeder sieht es, jeder hat Angst davor und doch wird es von so vielen ignoriert.
Doch jeder Markt funktioniert nach diesen Regeln. Es wird eine Abwärtsbewegung geben, das ist bereits klar. Ob sie abrupt einsetzen wird und in einem Crash mündet oder ob sie in einer langsamen, stetigen Abwärtsbewegung ihren Abschluss findet, hängt von vielen Faktoren ab. Einer davon ist, wie stark die Märkte überhitzt sind und wie weit die Ertragserwartungen der Anleger von der Realität entfernt sind. Die Erwartungen im Markt und die Kurse und Kurs/Gewinn-Verhältnisse müssen wieder auf den Boden der Tatsache zurückgebracht werden.
Ein Crash bedeutet neben all den negativen Effekten und Nachwehen halt auch, dass wir zu einem gesünderen, stabileren Fundament für die Börse und die Wirtschaftsaktivitäten zurückkommen.
Der Crash ist nicht die Schieflage, der Crash IST die Korrektur der Schieflage der Märkte. Das Kartenhaus, das sich Anleger, Unternehmen und die Regierenden gebaut haben, droht einzustürzen. Und anstatt die Konstruktion zu verstärken, versucht man noch ein Stockwerk obendrauf zu setzen.
Das Kartenhaus stürzt ein
Und dann braucht es nur einen kleinen Wackler, eine Karte, die wegrutscht, oder einen Luftzug und alles fällt in sich zusammen. Wer schon mal Kartenhäuser gebaut hat, der weiß, dass im ersten Moment die Enttäuschung groß ist. Wenn man im Wettbewerb mit anderen baut, kann es sogar schmerzhaft sein, wenn der eigene Bau einstürzt. Aber in der Regel lernt man daraus. Man baut das nächste Kartenhaus stabiler, mit einem sicheren Fundament, mit Stützen an den Seiten und mit weniger Risiko.
Bezogen auf den Crash kann man sagen, dass das, was danach kommt profitiert von den aktuellen Fehlern die wir machen. Man konnte das ganz deutlich in der Folge der Finanzkrise sehen, wo als Ergebnis die Aktionsradien der Banken beschnitten wurden und die Banken verpflichtet wurden für eine bessere Eigenkapitaldeckung zu sorgen.
Leider zeigt sich im Laufe der Zeit, dass die Gier die Banker weitgehend resistent gegen Lerneffekte macht und sie jedes Schlupfloch zur Gewinnmaximierung nutzen, sei es legal oder illegal. Stichwort Cum-ex-Geschäfte. Und auch die Deregulierung der Banken und die Aufweichung des Konsumentenschutzes, wie sie derzeit durch Donald Trump in den USA vollzogen wird, zeigen deutlich den Einfluss der Banken und wie schnell diese schmerzhaften Lehren aus der Vergangenheit auf politischer Ebene wieder verdrängt werden.
Trotzdem ist ein kräftiger Dämpfer auch für die Banken und die Politik ein gutes Mittel, um sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurück zu holen und die gesetzlichen Leitschienen und Grenzen neu zu definieren. Und eine aus dem Crash resultierende Rezession und eventuelle Weltwirtschaftskrise, deren Verursacher sehr leicht zu benennen sind, dürfte dazu führen, dass tiefere Eindrücke und Konsequenzen zurückbleiben, die das weltweite Wirtschaftsleben auf Jahrzehnte prägen werden.
Vermutlich wird es nur einen Menschen weltweit geben, der mit Sicherheit keine Schuld an dem Zusammenbruch hat: Donald Trump. Der findet ja immer einen anderen Schuldigen.
KI-Entwicklung: Pause zum Nachdenken
Ein weiterer Vorteil eines Crashs könnte sein, dass dadurch die Entwicklungen im Bereich der KI verlangsamt werden. In den vergangenen drei Jahren hat sich in diesem Bereich so viel getan, dass es kaum möglich ist mit all den Entwicklungen Schritt zu halten. Das geht nicht nur Otto-Normalverbraucher so, sondern auch den Experten in diesem Segment. Und erst recht unseren Politikern.
Die Entwicklungen im Bereich KI brauchen mehr Aufsicht, mehr Regulierung, mehr Strukturierung und einen Fokus auf das Gute, den positiven Nutzen für die Menschheit. Gerade dieser Fokus geht in der gegenwärtigen Diskussion, um die Existenz der Blase und die Wahrscheinlichkeit eines Börsencrashs verloren. Relevant nicht mal wirtschaftliche Erfolge, Zahlen, Fakten, sondern nur noch die übertriebene Kursphantasie.
Der Zusammenbruch der finanziellen Macht, die sich derzeit in dieser Blase manifestiert, würde es nötig machen die gesamte Entwicklung der Wissensbasis, die Notwendigkeit all dieser wahnsinnigen Investitionen und den erhofften Erfolg zu überdenken. Überleben würden die finanzstarken Unternehmen (was nicht zwangsweise gut sein muss) wie Google, Amazon und Meta, die nicht nur genug Reserven haben, sondern auch hohe, nicht versiegende Einkommensströme. Überleben würden auch die Unternehmen, die schon jetzt eine gesunde Finanzierung haben und ein Geschäftsmodell, das so viel Mehrwert schafft, dass dadurch auch genügend Ertrag erwirtschaftet wird, um das Unternehmen lebensfähig zu erhalten.
An der ein oder anderen Stelle wird der Staat einspringen, um Arbeitsplätze oder den Technologievorsprung oder den Status quo zu sichern. Doch das wird sich in Grenzen halten, da dieses Wirtschaftssegment zwar derzeit Unsummen verschlingt, aber noch nicht wirklich relevant für Millionen von Arbeitsplätzen oder lebenswichtige Industrien ist.
Stattdessen wird man auf einen Selbstheilungsprozess setzen, bei dem die Starken die Schwachen schlucken oder ersetzen. Das führt dazu, dass sich diese Branche zumindest für eine gewisse Zeit mehr um sich selber drehen wird und damit beschäftigt sein wird dem Anderen die Augen auszuhacken. Ähnlich wie heute bei den Betriebssystemen für unsere Computer und den Browsern mit denen wir durch das Netz surfen, wird es eine Konzentration auf weniger Anbieter und wenige Produkte geben, die diesen Bereich abdecken.
Daneben wird es eine Vielzahl von Unternehmen geben, die sich auf Nischen oder besondere Anwendungen konzentrieren und KI-basierte Lösungen anbieten, die so gut sind, dass Kunden auch gut dafür bezahlen. Denn die Finanzierung solcher Unternehmen dürfte aufgrund des Crashs für lange Zeit sehr schwierig werden, wenn die Gewinnaussichten in weiter Ferne liegen.
Natürlich werden im Zuge der Börsenkrise auch Unternehmen ins Straucheln geraten, die nichts mit der KI-Branche zu tun haben. Das Abwägen, ob es in diesen Fällen Sinn macht von staatlicher Seite unterstützend einzugreifen, wird eine echte Herausforderung für die Politik sein und kann zu dramatischen Verwerfungen führen.
KI bleibt – auch nach dem Crash
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass auch das Platzen der KI-Blase nicht dazu führt, dass KI aus unserem Alltag verschwindet. Selbst wenn die Entwicklung von neuer, besserer KI sich verlangsamen sollte, so wird die Entwicklung durch einen Börsencrash ja nicht gestoppt.
Das bedeutet, die Herausforderungen, die absehbar durch KI auf uns zukommen, wie massiver Abbau von Arbeitskräften, höhere Arbeitslosenzahlen, das Absterben bestimmter Industriezweige, wachsende finanzielle Ungleichheit, wachsender wirtschaftlicher Druck aus dem Ausland, all diese Herausforderungen bleiben erhalten. Dafür müssen wir Antworten und Lösungen finden.
Das heißt die Regierenden, weltweit, nicht nur bei uns in Deutschland, müssen sich dann Gedanken machen, was Sinn macht es zu erhalten und wovon wir uns trennen müssen, angesichts der aktuellen und zukünftigen realen Einflüsse von KI in unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Das wird schmerzhafte Konsequenzen haben und es wird weniger Kompromisse geben als in der Vergangenheit.
Zwar werden Politiker nach wie vor an ihren Ämtern kleben und alles in ihrer Macht Stehende tun, um diese zu behalten. Aber der politische Druck wird wachsen und er wird nicht nur von Seiten der Reichen und Mächtigen und von Seiten der Unternehmen kommen. Denn Millionen von Menschen werden in der Zeit nach dem Crash leiden. Sehr leiden.
Wer zahlt die Zeche?
Ich denke, es ist ein realistisches Szenario davon auszugehen, dass die mittleren und unteren Einkommensschichten am meisten unter den Folgen einer Weltwirtschaftskrise leiden werden. Ein Crash trifft immer die Verwundbarsten am stärksten. Und wenn es keine Bemühungen gibt diese Folgen schon im Vorhinein zu begrenzen und der politische Diskurs dahingeht, denen die fast nichts haben einen Teil davon wegzunehmen, kann man auch in Zeiten größerer Not angesichts leerer Kassen nicht mit größerer Freigiebigkeit des Staates rechnen.
Wenn man die aktuelle Diskussion über Nebenschauplätze wie das Bürgergeld oder über Migranten betrachtet, so wird schnell eine Verdrängungstaktik sichtbar. Auch die neue Regierung will nicht die wirklich heiklen Themen angehen, sondern versucht angesichts mieser Umfrageergebnisse auf den Zug gegen die Schwächsten aufzuspringen, um den Stimmenabfluss zur AfD und zu den Linken zu stoppen.
Nach meiner Meinung sollte man sich angesichts einer bevorstehenden und absehbaren Weltwirtschaftskrise viel mehr Gedanken darüber machen, wie man einerseits die Wirtschaftsleistung in der Krise abfedern kann. Und andererseits sollte man sich genauso darüber Gedanken machen, dass enorme Belastungen auf unser soziales Netz zukommen, denen man vorauseilend Aufmerksamkeit schenken muss. Sonst laufen wir Gefahr wie bei der ersten Weltwirtschaftskrise in Kürze weitere Millionen von Arbeitslosen auf unseren Straßen zu haben, die womöglich irgendwann auf die Barrikaden gehen.
Es wäre sinnvoll jetzt nicht nur wieder herumzudoktern und Haushaltslöcher zu stopfen, die nach einem Crash um ein Vielfaches größer sein werden, wenn man nicht proaktiv die sozialen Netze neu erfindet und Menschen in Notsituationen mehr Hilfe zur Selbsthilfe statt Almosen gibt. Dabei sollten wir meiner Meinung nach weniger über Kürzungen der Leistungen, sondern eine effektivere und schlanke Verwaltung nachdenken. Wir müssen den Bürokratieabbau vorantreiben, die Kosten für Weiterbildung reduzieren und das Angebot ausweiten.
Wir sollten Jobs in der Alten- und Krankenpflege attraktiver machen und besser bezahlen. Wir müssen dringend mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen und dafür den Vorschriftendschungel abbauen, Mietpreisbremsen konsequent durchsetzen und Mietwucher bestrafen.
Wir müssen rüstige Rentner nicht nur auffordern länger zu arbeiten, sondern auch dafür Sorge tragen, dass Unternehmen sie einstellen bzw. länger beschäftigen. Da müssen neue Ansätze her wie wir die Menschen 50+ wirklich in den Arbeitsmarkt integrieren und ihre Chancen auf adäquate Beschäftigung fördern.
Die Ideen für alle diese Bereiche der sozialen Absicherung müssen wir jetzt suchen, solange die Blase noch existiert. Die Weichen hin zu stärkeren sozialen Netzen müssen wir jetzt stellen. Und wir müssen schnell sein, wenn wir verhindern wollen, dass Millionen von Menschen ins Bodenlose fallen.
Denn eines ist auch klar: KI wird in den kommenden Jahren nicht nur Millionen von Jobs verändern, sie wird auch Hunderttausende von Jobs überflüssig machen. Wir müssen uns also auf gravierende gesellschaftliche Veränderungen vorbereiten. Durch KI wären diese sowieso in den kommenden Jahren auf uns zugekommen. Doch mit einer Weltwirtschaftskrise kommen diese gesellschaftlichen Verwerfungen in einem noch viel schnelleren Tempo auf uns zu als befürchtet.
Politische Instabilität und Extremismus
Man muss davon ausgehen, dass auf der politischen Ebene die extremen Parteien links und rechts der Mitte am meisten profitieren würden. Auch wenn sie mit einer solchen Krise vermutlich nicht besser umgehen könnten, vielleicht sogar wegen mangelnder politischer Erfahrung noch gravierendere Fehler machen würden, ist davon auszugehen, dass sie die Krise nutzen können, um weiteren Stimmenzuwachs zu generieren.
In der Folge ist eine größere politische Instabilität in Deutschland, Europa und vielen anderen Ländern der Welt zu erwarten. Die Geschichte hat gezeigt: Wir müssen uns auf mehr Abschottung, mehr Fokus auf Eigennutz, mehr Proteste und Konfrontation, mehr Fremdenhass und mehr Armut einstellen.
Doch überall wo ein Risiko ist, da sind auch Chancen. Die Geschichte zeigt uns: Es ist viel leichter auf den Ruinen eines alten Imperiums etwas Neues aufzubauen, als ein dem Tode geweihtes System zu kurieren. Dieser sich androhende Crash, könnte vermutlich die dramatischen Folgen der Weltwirtschaftskrise nach 1929 noch übertreffen. Dramatische Veränderungen im politischen System, im Wirtschaftssystem, in der Zusammenarbeit der Staaten und in den Machtverhältnissen auf der Erde wären die Folge.
Und erstmals seit hundert Jahren werden Strukturen zusammenbrechen, an denen unsere Gesellschaft seit Jahrzehnten herumbastelt, damit sie noch eine oder zwei weitere Legislaturperioden funktionieren. Wir werden sehen wie Banken und große Unternehmen ins Stolpern geraten, wie Volkswirtschaften den Bach hinuntergehen und Allianzen zerbrechen. Wir werden mehr Missgunst erleben, mehr Konfrontationen und vermutlich auch Kriege in den kommenden Jahren.
Aber der Crash und die erste Zeit danach werden auch ein Moment des Innehaltens sein. Ein Moment, in dem wir durchatmen müssen, uns neu ausrichten müssen und die Chance haben Dinge besser zu machen als bisher.
Die Chancen nach dem Crash
Wenn man es positiv betrachtet, dann ist es ja so: Nach einem Crash, wenn die Blase geplatzt ist, sind die Märkte oft wieder realistischer bepreist. Das heißt es gibt auch wieder mehr Chancen für kleine Unternehmen und Menschen mit neuen Ideen. Es wird neue Arbeitsplätze geben, die auf realistischeren Grundlagen fußen. Die Wirtschaft kann nach einem Gesundschrumpfen neu aufblühen und die Mittelschicht und die ärmere Bevölkerung haben die Chance stabilere Arbeitsplätze zu finden. Aber das wird ein langer Weg.
KI wird unsere Arbeitswelt und damit auch unser soziales Miteinander in Zukunft stark prägen. Ein so dramatischer Einschnitt wie eine Weltwirtschaftskrise birgt eine Menge Risiken und Ungewissheit in sich, für viele auch Armut, Leid, Verlust von Arbeit, Einkommen und Lebenssinn.
Aber sie bringt auch eine Menge neuer Chancen. Chancen, die wir aktiv ergreifen müssen, wenn wir nicht wieder wie nach 1929 in ein düsteres Zeitalter mit Krieg, autoritären Regimen und dem Bankrott unserer Demokratie enden wollen.
Denkbar ist eine Verschiebung der globalen Kräfteverhältnisse, wie wir es ja bereits in den vergangenen zehn Jahren beobachten konnten. Denkbar ist, dass sich Handelsströme verlagern, dass Finanzquellen versiegen, Staaten bankrottgehen und durch alles das neue Strukturen in Märkten und politischen Allianzen entstehen. Neue Abhängigkeiten eventuell, aber auch Neuanfänge. Dinge werden sich neu ordnen oder durch Marktkräfte, politischen Einfluss oder militärische Auseinandersetzungen neu geformt werden.
Eine Neuordnung der Finanzmärkte könnte vor allem aufgrund der derzeitigen Finanz- und Fiskalpolitik der Trump-Regierung die Dominanz des Dollars brechen. Das könnte aufstrebenden Volkswirtschaften mehr Spielraum geben.
Der Zusammenbruch alter Handelsstrukturen eröffnet neue Räume für neue, gleichberechtigtere Partnerschaften. So könnte der globale Süden endlich ein gleichrangiger Partner in der Gemeinschaft der Staaten werden.
Eine Neuordnung der Strukturen bietet auch die Chance auf eine Welt, in der Vermögen und Einkommen in unserer Gesellschaft gerechter verteilt werden. Eine Welt, in der politische Bünde wie die EU effektiver funktionieren und Mehrwert für die Bürger schaffen, statt eines teuren Verwaltungsapparates.
Mithilfe von KI können wir außerdem in Zukunft Bildung noch mehr demokratisieren. Bildung kann kostengünstiger und nach individuellem Bedarf angeboten werden.
Wir können unseren Fokus in sozialen Medien neu ausrichten: weg von Konsum und Oberflächlichkeit, hin zu mehr sozialem Miteinander. Zwar postet heute nicht mehr jeder seine Mahlzeiten auf Facebook oder Instagram, jedoch sind die sozialen Medien verkommen zu einem Zirkus der Selbstdarsteller, der Marktschreier und der Influencer.
Es geht doch schon längst nicht mehr um den sozialen Aspekt, sondern in erster Linie ums Geld machen. Eine weltweite Krise wie die von 1929 würde uns alle zum Innehalten zwingen, zum Nachdenken und womöglich zu dem Gedanken, dass wir soziale Medien vielleicht mehr im wörtlichen Sinne nutzen sollten. Nämlich um soziale Kontakte zu pflegen.
Ein Crash mit so enormen wirtschaftlichen Folgen wie die Weltwirtschaftskrise Anfang des letzten Jahrhunderts würde auch die Arbeitswelt vor große Herausforderungen stellen. Millionen würden zumindest vorübergehend ihren Arbeitsplatz verlieren. Viele müssten sich umorientieren. Und da KI nicht mit dem Crash aus unserem Alltag verschwinden wird, werden viele ihre Jobs verlieren, ohne die Chance auf spätere Wiedereinstellung.
Künstliche Intelligenz wird Arbeitsplätze vernichten. Über das Ausmaß lässt sich streiten. Aber auch in diesem Bereich kann sie uns vermutlich neue Chancen eröffnen.
Vielleicht ermöglicht uns KI irgendwann das, was wir heute „Arbeit“ nennen, in die zwei wichtigsten Faktoren aufzuteilen, die dann unabhängig voneinander existieren könnten: nämlich eine „Aufgabe“ zu haben und ein „Einkommen“. Das oben gezeichnete Szenario einer Weltwirtschaftskrise nach dem Platzen der KI-Blase bietet mindestens ebenso viel Chancen wie Risiken. Wir müssen uns engagieren und die gebotenen Chancen nutzen. Noch haben wir Zeit, uns vorzubereiten. Noch können wir im Wissen um die Risiken vorsorgen. Noch haben wir Zeit, uns Gedanken über die Welt von morgen zu machen. Wenn die Blase erst einmal platzt, ist das, was kommt, von heute auf morgen die neue Realität. Es ist besser schon heute zu gestalten als morgen nur noch reagieren zu können.
Das könnte dich auch interessieren

Die überforderte Gesellschaft
2. November 2025
Positive Visionen entwickeln für eine inklusive technologische Zukunft
11. November 2025