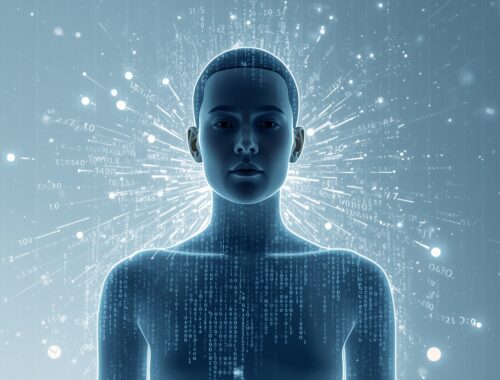Positive Visionen entwickeln für eine inklusive technologische Zukunft
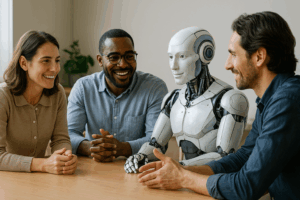
Künstliche Intelligenz ist dabei, unsere Gegenwart zu verändern. Jeden Tag ein wenig mehr. Jeden Tag ein wenig spürbarer. Und künstliche Intelligenz wird auch großen Einfluss darauf haben wie die Menschheit, der Planet und das Leben jedes Einzelnen von uns sich in Zukunft entwickeln werden.
Vollkommen egal, ob man auf der Seite der KI-Enthusiasten steht oder auf der Seite der Endzeitprognostiker: Die Entwicklung in dieser Branche lässt sich vermutlich nicht mehr stoppen, allerhöchstens verlangsamen. Künstliche Intelligenz bietet eine Menge Chancen, aber birgt auch erhebliche Risiken.
Meiner Meinung nach müssen wir weg von den Hypothesen, die sich mit den Extremen befassen und uns darauf einlassen realisierbare positive Visionen zu entwickeln. Auch wenn wir der Technik kritisch gegenüberstehen, ist es wichtig sie zu verstehen und in unserem Sinne zu nutzen. Das betrifft jeden einzelnen.
Neue Ideen für eine lebenswerte Zukunft
Wir müssen uns fragen: Wie können wir KI sinnvoll in unser Leben integrieren? Vor allem müssen wir Wege finden, wie wir als Gesellschaft alle mitnehmen, sodass wir eine inklusive technologische Zukunft schaffen. Diese sollte nicht nur alle Menschen unabhängig von ihren spezifischen Merkmalen und alle Gesellschaftsgruppen einschließen, sondern auch unseren Planeten, unsere Umwelt, Pflanzen und Tiere.
Wir müssen Visionen entwickeln, die das Leben nicht nur für Einzelne, sondern für die Gesamtheit besser machen und zwar langfristig. Dazu gehört auch, dass wir bei der Nutzung von KI verantwortlich mit den Ressourcen unseres Planeten umgehen. Wir sollten nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben in der Hoffnung, dass auf lange Sicht die KI schon alles regeln wird.
Denn das wird sie in vielen Bereichen nicht können. Selbst wenn sie irgendwann einen Status erreicht, in dem sie intelligenter ist als alle Menschen dieser Erde zusammen. Die Natur zeigt uns immer wieder wie machtlos wir in Wirklichkeit sind, auch wenn wir in immer mehr Bereichen versuchen Einfluss zu nehmen um die Natur zu beherrschen.
Also, machen wir uns auf zu neuen Ufern, die wir mit Hilfe der KI erreichen können. Lasst uns neue Utopien denken, im Kleinen wie im Großen. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan der Ideen von Elon Musk, der Menschen auf den Mars schicken will. Oder von Jeff Bezos, der meint, dass in zwanzig Jahren Millionen von Menschen in einem Habitat im Weltraum leben werden. Aber auf der anderen Seite können wir wahrscheinlich nur Großes erreichen, wenn wir groß denken. Dies gilt auch für Utopien.
Mir geht es aber eher darum, dass wir Dinge machen, um die Lebensbedingungen hier auf der Erde zu verbessern. Wie zum Beispiel unsere Umwelt sauberer zu halten oder zu machen, Gefahren abzuwenden, den Alltag zu erleichtern.
Musk, Bezos und andere Superreiche geben Milliarden aus, um ihre kommerziellen und machtbezogenen Interessen zu realisieren. Dabei verfolgen sie Ideen im Weltraum, die weder kurz- noch mittelfristig der Menschheit von echtem Nutzen sein werden. Im Gegenteil: der Weltraumschrott, den die Firmen dieser zwei Menschen produzieren gefährden unsere Umwelt und wichtige Kommunikations- und Forschungssatelliten. Daran wird deutlich, wie traurig es ist, dass so viel Sinnvolles was man mit diesem Geld hier auf der Erde bewirken könnte unerledigt bleibt. Wenn man außerdem sieht, wie diese Aktivitäten Ressourcen verschwenden und die Umwelt verpesten, kann es einen nur wütend machen.
Daher sollten wir unsere eigenen Utopien entwickeln. Kleiner vielleicht, feiner vielleicht und wirkungsvoll und hilfreich für die Gesellschaft oder die Menschen in unserem direkten Umfeld. Und dabei sollten nicht immer in erster Linie kommerzielle Interessen im Vordergrund stehen. Wir sollten vielmehr über Projekte nachdenken, die Problemlöser entwickeln, bevor man darüber nachdenkt wie man damit Geld verdienen kann.
KI demokratisiert Expertise
Die Arbeit an solchen Projekten kann man auf viele Schultern verteilen. Denn mit der Hilfe von KI können heute auch themenfremde Laien sich in kurzer Zeit Expertise aneignen. So kann jeder ein Aktivposten bei der Entstehung von Ideen für das Wohl der Gemeinschaft oder Einzelner sein.
Dazu müssen wir in einem ersten Schritt Problemfelder und Wirkfelder identifizieren. Wo können wir durch den Einsatz von KI etwas positiv verändern? Dafür könnte man eine Art „Problembörse“ schaffen. Dort können Ideen zu Problemen und gesellschaftlichen oder umweltbezogenen Themen gesammelt werden und mögliche oder gewünschte Lösungsansätze diskutiert werden.
Sicherlich fehlt es in vielen Fällen nur an dem notwendigen Wissen oder an einem cleveren Gedankengang, um eine Vielzahl unserer Probleme und Problemchen zu lösen. Dabei kann sowohl KI als auch die Zusammenarbeit in Projektgruppen ein guter Anfang sein. Menschen treffen sich auf diesen Plattformen, um konstruktiv, positiv und visionär Lösungen zu finden.
Durch die Technologie wird nicht nur der Einzelne ermächtigt mehr zu erreichen. Sie wird auch dazu führen, dass in Gruppen anders kooperiert werden kann und schneller bessere Ergebnisse erarbeitet werden können. Doch wie lässt sich dieser Fortschritt gestalten?
Fortschritt aktiv gestalten
Wenn wir Fortschritt nicht nur in der Raumfahrt, sondern auch im gesellschaftlichen Miteinander, am Arbeitsplatz oder in Bezug auf unsere Umwelt erreichen wollen, ergibt sich daraus die Notwendigkeit, den Fortschritt auch aktiv mitzugestalten. Das betrifft nicht nur die Milliardäre. Das betrifft uns alle. Dazu brauchst es nicht immer Milliarden an Investitionen, oft noch nicht mal Millionen. Es braucht in erster Linie Menschen die glaubhaft und engagiert daran arbeiten, Probleme zu lösen und diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Wir sollten uns mehr auf das fokussieren, was wir beeinflussen können oder abstellen können. Und wir sollten nach Wegen suchen wie wir die Technik nutzen können, um den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fördern und Alltagsprobleme zu lösen.
Werte, Partizipation und Transparenz
Grundlage dieser Aktionen müssen gemeinsame Werte sein, die alle Beteiligten teilen. Nur so ist gewährleistet, dass der erste Impuls in eine beharrliche und zielorientierte Zusammenarbeit kanalisiert wird, die brauchbare Ergebnisse erzielt. Die betroffene Gemeinschaft muss von Anfang an in die Problemdefinition, das Lösungsdesign und die iterativen Prozesse einbezogen werden. Nur durch Beteiligung und laufendes Feedback, wird gewährleistet, dass die Lösung auch wirklich gesellschaftlichen Nutzen bringt. Das ist natürlich umso schwieriger, je größer die jeweilige Gemeinschaft ist, die partizipiert und von dem Projekt einen Nutzen haben soll.
Daher ist es wichtig kleine, lokale Projekte zu starten, die Nähe und Vertrauen schaffen. Wichtig ist auch, Fortschritte am Projekt zeitnah zu kommunizieren und Iterationen mit Feedback zu untermauern. Transparenz und Nachvollziehbarkeit müssen auch für den interessierten Laien gegeben sein. So wird sichergestellt, dass Entscheidungen und Änderungen am Konzept von der Gemeinschaft mitgetragen werden.
KI sollte dabei immer als ein Werkzeug oder eine Hilfe angesehen werden. Die Kontrolle und die Verantwortung sollte der Mensch niemals aus der Hand geben. Und der moralisch relevante Kontext muss exakt von der Gemeinschaft vorgegeben werden. Die KI hilft, analysiert und führt aus, was der Mensch oder die Gemeinschaft ihr vorgibt. Sie darf nicht das menschliche Urteil ersetzen.
Der Fokus sollte ganz pragmatisch auf Machbarkeit und auf eine echte Verbesserung des gemeinschaftlichen Wohls liegen. Nicht der Flug zum Mars in 15 Jahren oder die Ausrottung von Krebs in 20 Jahren ist dabei das Ziel. Sondern kleine, positive Veränderungen im Alltag, jetzt!
Mitbestimmung als Schlüssel
Damit wir Mitmenschen für solche Projekte gewinnen können, müssen Mitbestimmung und demokratische Prozesse garantiert werden. Diejenigen, die sich einbringen müssen die Möglichkeit haben, Prioritäten, den Datenzugriff und die Ethik mitzubestimmen. Denn das ist der entscheidende Knackpunkt bei der Sache: Wie schaffen wir es eine soziale Gruppe zu bilden, die bereit ist mitzumachen? Wie bringe wir die Menschen dazu Ideen beizusteuern und auch die Verantwortung mitzutragen?
Dazu ist es notwendig realistische Bilder von unseren Visionen aufzuzeigen. Sie sollen den Menschen vor Augen führen, was ihr Engagement in dieser Gemeinschaft bewirken kann. Nicht nur der Sinn des Projektes muss in dieser Vision deutlich werden, sondern auch der Nutzen, den die Gemeinschaft oder der Einzelne dadurch hat.
Das kann, aber muss nicht zwingend ein monetärer Vorteil sein. Es kann sich in Zeitersparnis, schönerer Umweltgestaltung, bessere Integration, besserer Gesundheit, persönlicher Anerkennung oder schlichtweg in einem besseren Lebensgefühl ausdrücken. Doch dieses Bild muss von der Vision unmissverständlich transportiert werden. Und es muss ansprechend sein, so dass Menschen aus eigenen Antrieb ein Teil davon sein wollen. Diese Aufgabe, die Menschen für die Vision zu begeistern, ist sicherlich die schwierigste.
Hilfreich kann dabei auch eine Incentivierung der Mitarbeit sein, die nicht primär monetär sein muss. Sie kann symbolisch sein, durch Urkunden, öffentliche Anerkennung und kleine Preise, die Namensnennung von Mitwirkenden im öffentlichen Rahmen. Aber auch die steuerliche Abzugsfähigkeit für Spenden zum Projekt wäre eine Möglichkeit
Neben einem einfachen Einstiegs in die Mitarbeit am Projekt ist die öffentliche Sichtbarkeit der Vision von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören Öffentlichkeitsarbeit, die Präsenz in lokalen Medien und in den sozialen Medien, oder die Ausstellung von Ergebnissen der Arbeit. SO können Menschen zur Mitarbeit motiviert werden.
Finanzierung jenseits der Milliardäre
Dieser Essay würde sicherlich zu lang, wenn hier auch noch konkrete Beispiele und Projekte erörtert würden. Dies soll zu einem anderen Zeitpunkt in separaten Artikeln an dieser Stelle geschehen. Ich möchte allerdings noch auf zwei wichtige Punkte eingehen, die für den Erfolg einer inklusiven technologischen Zukunft notwendig sind. Das ist zum einen die Infrastruktur, die gebildet werden muss, damit die vielen kleinen Projekte auch gesamtgesellschaftlich ihre Wirkung entfalten können. Und zum anderen ist es die Frage der Finanzierung von solchen Projekten. Denn, auch wenn wir keine Milliarden oder Millionen brauchen, können die meisten Projekte nicht ohne einen gewissen Grundstock an finanziellen Mitteln umgesetzt werden.
Das Gute ist, dass die derzeit verfügbare KI-Systeme, die für die Allgemeinheit verfügbar sind nicht nur erschwinglich sind (teilweise sogar kostenlos zur Verfügung stehen). Sie sind auch einfach und ohne aufwendige Schulung oder Ausbildung für jedermann nutzbar. Wenn es dann aber um die Durchführung konkreter Projekte geht können Kosten für Hardware, Sensorik, Serverkosten, spezielle Schulungen oder die Öffentlichkeitsarbeit entstehen. Die müssen irgendwie gedeckt werden.
Die grundsätzliche Idee, dass die Finanzierung möglichst ohne den Staat, Großkonzerne oder Milliardäre funktionieren soll, bedeutet, dass das Aufbringen der Mittel auf alternativen teils unkonventionellen Wegen vonstattengehen muss.
Eine Möglichkeit der Finanzierung ist dabei das Crowdfunding. Ein Crowdfunding, das nicht auf eine Gegenleistung in Form eines Produktes oder einer Leistung für den Geber ausgerichtet ist. Ziel ist vielmehr einen kollektiven Mehrwert zu schaffen. Ein Beispiel dafür ist die Plattform Goteo in Spanien. Dort kann man Leistungen nicht nur monetär, sondern auch in Form von Arbeitsstunden oder dem Abarbeiten von Aufgaben erbringen.
Überhaupt sind Zeit- und Sachleistungen eine Möglichkeit für sehr viele, sich in unterschiedlichem Ausmaß einzubringen. Das können Einzelpersonen ebenso wie die Kommune oder kleine Firmen sein. Mögliche Spenden könnten die Nutzung von Räumen oder Material sein. Denkbar ist das Zur-Verfügung-Stellen von Ressourcen wie Computer, Speicher- oder Rechenkapazitäten, Verpflegung für Mitwirkende, oder Fahrgelegenheiten. Unternehmen könnten partizipieren durch Freistellung von Mitarbeitern für Aktivitäten am Projekt als Corporate Social Responsibility. Dabei darf die Mitarbeit jedoch nicht das Projekt dominiert.
Geht es um eine eng umgrenzte Gruppe, einen Stadtteil oder eine kleine Kommune, so sind auch Finanzierungen über Mitgliedsbeiträge, Mikrospenden von Unternehmen denkbar ohne wirtschaftlichen oder werbewirksamen Vorteil. Oder über die Gründung einer Genossenschaft. Diese Modelle machen Sinn, wo sich der Erfolg beziehungsweise der Nutzen des Projektes aufteilen lässt auf einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen für die Gemeinschaft oder Kommune und einen individuellen Nutzen, der nur den Mitgliedern zugute kommt.
Projekte, die eine größere Finanzierung benötigen, könnten über die Gründung von Stiftungen, Poolfinanzierung (viele Spender bringen ihren finanziellen Beitrag und ein demokratisch bestimmtes Gremium entscheidet über die Verwendung der Mittel) akquiriert werden. Oder über Kooperationen mit lokalen Unternehmen oder Stiftungen, ohne dass die Projektziele primär kommerziell ausgerichtet sind.
Denkbar sind auch Einzelinvestoren, deren Ziel nicht die Profitmaximierung ist, sondern der Wunsch einen starken, spürbaren, sozialen Nutzen zu erzielen, wobei der Rückfluss der Investition in die Gemeinschaft erfolgen sollte.
Infrastruktur für gemeinwohlorientierte Innovation
Zum Schluss noch ein Blick auf die Infrastruktur, die nötig ist, um gesamtgesellschaftlich positive Visionen für eine inklusive technologische Zukunft zu entwickeln:
Um den Gedanken einer Infrastruktur für positives Changemanagement im lokalen Bereich umzusetzen, braucht es eine Online-Ideenplattform für die regional betroffene Zielgruppe. Auf dieser Plattform werden zunächst Ideen aller Art, die von Mitbürgern eingereicht werden gesammelt, sortiert und kuratiert. Die Ressourcen für solch eine Plattform könnten von Unternehmen, Einzelpersonen oder Kommunen gestellt werden; Mischformen sind denkbar. Wichtig ist, dass das Ziel der Plattform das Gemeinwohl und nicht Profit ist.
Interessierte Personen könnten im Anschluss die Projekte diskutieren, bewerten und priorisieren. Interessierte Freiwillige nehmen im nächsten Schritt die Planung des Projektes vor und beschaffen notwendige Ressourcen. Auf der Plattform könnte ebenfalls dann ein Matching mit den Kompetenzen einzelner Community-Mitglieder erfolgen. Do kann in kurzer Zeit ein Team mit der Umsetzung der Idee beginnen.
In der Folge können Erfahrungen und relevante Datensätze, die man gesammelt hat, in der Datenbank der Ideenplattform abgespeichert werden. Bei Bedarf können sie dann für andere Projekte dort abgerufen werden.
Wichtig für die Zusammenarbeit wäre auch ein Ort, an dem sich Projektmitglieder oder Interessierte treffen können und sich austauschen können. Das fördert nicht nur den Zusammenhalt innerhalb der Community, sondern hilft auch schneller Ideen und Gedanken auszutauschen und zu diskutieren. Denkbar sind hier Räume, die zu festen Zeiten offen zur Verfügung stehen. Oder aber eine Art Community-Café, in dem man sich zu bestimmten Öffnungszeiten zum Austausch oder gemeinsamen Arbeiten treffen kann.
Damit die Erfahrungen und die resultierenden Ergebnisse solcher Projekte aber nicht nur lokal, wo sie entwickelt werden, sondern auch an anderen Orten genutzt werden, ist eine Vernetzung der lokalen Ideenplattformen sinnvoll. Eine solche Netzwerkstruktur und die freigiebige Kooperation mit anderen lokalen Plattformen ermöglicht eine optimale Nutzung der erarbeiteten Lösungen auch an anderen Orten und sogar über Ländergrenzen hinweg.
Durch den Austausch von Best-Practice-Beispielen, Code-Modulen für KI-Entwicklungen und Datenquellen können einmal erarbeitete Lösungen mehrfach und optimal zum Gemeinwohl genutzt werden. Projektbeteiligte können als Mentoren in anderen Netzwerken helfen, die von ihnen gefundenen Lösungen umzusetzen. Als gleichberechtigte Knotenpunkte können alle angebundenen Plattformen gesellschaftlich sinnvolle Ideen und Lösungen anbieten und so Kooperationen zwischen Plattformen oder Kommunen beleben.
Kontrolle und Rahmenbedingungen
Bei Initiativen wie diesen besteht immer auch die Gefahr, dass etwas nicht so wie geplant verläuft. Deshalb braucht es für die Plattformen und die Arbeit in den Projekten Ethik-Verantwortliche, die verhindern, dass Projekte aus dem Ruder laufen. Das könnte Fragen des Datenschutzes, der Fairness oder möglicher negativer Nebeneffekte betreffen, die man zuvor bei der Planung nicht erkannt oder nicht entsprechend bewertet hat.
Denkbar ist hier, dass diese Ethik-Verantwortlichen außerhalb des Projekts agieren und als Kontrollinstanz dienen. Genauso gut wäre eine Konstellation denkbar, in der diese wichtige Rolle einem Mitglied des Projektteams übertragen wird, das die nötige fachliche Kompetenz und Autorität besitzt, um notwendige Korrekturen anzustoßen.
Sowohl die Entwicklung von Lösungen als auch spätere Änderungen sollten durch einen Mitbestimmungsprozess begleitet werden. Entscheidungen wie auch die gefundenen technischen Lösungen sollten jederzeit auditierbar sein. Persönliche Daten sollten, nur soweit unbedingt nötig, erhoben werden und so weit wie möglich anonymisiert werden. Die lokale Speicherung und die Sicherung des Datenschutzes gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen muss gewährleistet werden. Dafür müssen auch klare Verantwortlichkeiten schon zu Beginn der Projektarbeit entweder durch die Community oder durch ein Führungsteam festgelegt werden.
Eine inklusive technologische Zukunft ist machbar
Mit einer neuen Herangehensweise und einer von der Profitgier losgelösten Denkweise können wir durch den Einsatz von KI und Technologie echten Mehrwert für einzelne Gruppen und die gesamte Gesellschaft schaffen. Die Prinzipien für positive Utopien – Inklusion, Mitbestimmung, Transparenz, Datensparsamkeit – sind nicht neu. Neu wäre hingegen ihre konsequente Umsetzung in einer Zeit, in der technologische Entwicklung oft schneller voranschreitet als die demokratische Kontrolle.
Jeder Mensch hat die Möglichkeit in seinem persönlichen Umfeld Dinge zu beeinflussen und Dinge zu ändern. Das sollten wir auch tun und uns dazu mit Gleichgesinnten zusammenschließen. Letztlich ist es viel einfacher in kleinen Gruppen oder innerhalb einer Kommune Veränderungen umzusetzen, als auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Durch die oben genannte Vernetzung der Projekte können die dadurch erzielten Effekte trotzdem immens sein und weit über lokale Grenzen hinweggehen. Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit eine „neue“ Welt zu schaffen, die es wert ist darin zu leben.
Das könnte dich auch interessieren

Die überforderte Gesellschaft
2. November 2025
Wir brauchen den Crash der KI-Blase
15. November 2025