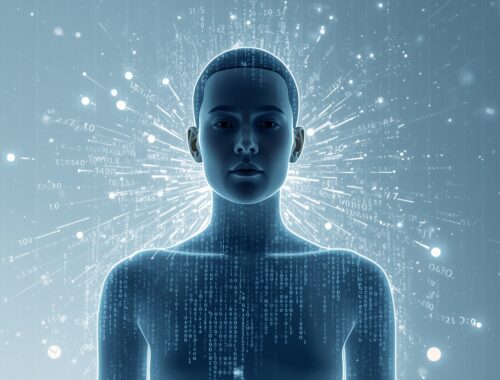Die überforderte Gesellschaft

Sind wir an einem Punkt angelangt, an dem nicht nur der einzelne Mensch, sondern auch die Gesellschaft als Gesamtheit mit den Entwicklungen unserer Epoche überfordert ist? Wird Überforderung zu einem vorherrschenden Lebensgefühl? Zur Quintessenz unseres Daseins? Und wie wird sich die zunehmende Durchdringung unseres Alltags durch künstliche Intelligenz darauf auswirken?
Ein guter Indikator für die Überforderung der Individuen in einer Gesellschaft ist die Entwicklung der psychischen Gesundheit. Dies lässt sich natürlich nur sehr bedingt in Zahlen ausdrücken. Ein verlässlicher Indikator kann jedoch beispielsweise die Entwicklung des Krankenstandes aufgrund von psychischer Erkrankungen sein. Aussagekräftig sind in Deutschland dabei die Erhebungen Krankenkassen zu den einzelnen Ursachen für Fehlzeiten. Dabei ist belegbar, dass in den vergangenen 10 Jahren die Anzahl der Fehlstunden um mehr als 50 Prozent angestiegen ist.
Eine wachsende Zahl von Arbeitnehmern klagt über vermehrten Stress am Arbeitsplatz. Der Fokus auf permanente Optimierung der betrieblichen Abläufe sowie eine Erwartungshaltung an jährliche Steigerungsraten und Ergebnisverbesserungen führt dazu, dass sich Arbeitsumfeld und Arbeitsabläufe immer weniger an den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Arbeitnehmer orientieren. Strikte Kontrollmechanismen machen jegliche Abweichung vom vorgegebenen Ziel taggleich bis ins kleinste Detail nachverfolgbar.
Dies führt zu andauernden iterativen Optimierungsversuchen, die ständige Veränderungen im Arbeitsalltag mit sich bringen. Der Frust, der damit einhergeht wird verstärkt durch die gleichzeitig stattfindende durch Standardisierung erzwungene Belanglosigkeit der Tätigkeiten und Zergliederung von Berufsbildern. Alles muss berechenbar und kontrollierbar werden, damit man den Wert der Arbeit beurteilen kann und die Abläufe im Sinne des wirtschaftlichen Ergebnisses optimieren und maximieren kann. Tristesse am Arbeitsplatz, Wechselgedanken, Quiet Quitting, Bore-out und Burn-out sind nicht selten die Folge und führen dazu, dass zunehmend Teile der Arbeitnehmerschaft einen schwer zu ertragenden Druck und damit einhergehend eine Überforderung empfinden
Die durchschnittliche Wartedauer auf einen Therapie-Ersttermin bei einem Psychologen liegt je nach Region und Bevölkerungsdichte zwischen 6 und 12 Monaten. Das bedeutet, dass nur in den seltensten Fällen ein Mensch, der in Deutschland unter Belastungsreaktionen oder Anpassungsstörungen leidet, schnelle Hilfe bekommen kann.
Stress auch im Privatleben
Doch die Überforderung zeigt sich nicht nur am Arbeitsplatz. Zunehmend empfinden Menschen auch im Privatleben Stress und Überforderung. Gesellschaftliche Veränderungen und Werteverschiebungen in Bezug auf Ehe, Familie, Beziehung, Sexualität, Freizeitgestaltung, Körperideale, politisches Gedankengut sowie all die Informationen aus aller Welt die auf uns einprasseln, führen dazu, dass wir uns permanent neu orientieren, neu ausrichten oder anpassen müssen. Das erfordert Kraft, Bereitschaft zu Veränderungen und bedeutet, dass wir nicht selten über bisherige Grenzen in unserem Leben hinausgehen müssen. Das bedeutet aber auch manchmal eine Überlastung unserer geistigen, körperlichen oder moralischen Kapazitäten, eine Überlastung unserer Fähigkeit Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten und eine Überlastung unserer Seele, weil unser Geist nicht mehr zur Ruhe kommt.
Zunehmende Isolation und Vereinsamung prägen das tägliche Leben immer größerer Bevölkerungsgruppen. Davon sind nicht nur ältere Menschen betroffen, sondern auch immer mehr jüngere Menschen, die ihre persönlichen Kontakte bewusst einschränken, oder die einfach nicht mehr den Zugang zu anderen finden, mit denen sie Erfahrungen, Erlebnisse oder das tägliche Leben teilen können. Die Digitalisierung unserer Welt, die ständige Reiz- und Informationsüberflutung sowie der durch soziale Medien verbreitete Druck nach Perfektion, der vor allem auf viele junge Menschen Einfluss nimmt, führen häufig zu einer Hilflosigkeit und Apathie, die sich in einem seelenlosen Konsumieren von Social Media-Inhalten manifestiert. Gefördert wird dies durch Algorithmen, die Suchtverhalten belohnen und Isolation fördern.
Dies zeigt sich nicht nur in permanent steigenden Nutzerzeiten für Social Media-Seiten und Onlinespielen, sondern auch in den unglaublichen wirtschaftlichen Bewertungen und Ergebniszahlen, die Unternehmen wie Meta, Google oder Bytedance erwirtschaften.
Ohnmacht angesichts weltweiter Probleme
Neben den Herausforderungen und Bedrohungen im Arbeitsleben und im privaten Bereich gibt es eine dritte, globale Komponente ausgelöst durch weltweite oder regionale Ereignisse und Entwicklungen, die viele Menschen mit Angst erfüllt – und auch mit einem Gefühl der Ohnmacht, weil wir als Einzelne nichts daran ändern können und es keinen gesamtgesellschaftlichen oder weltweiten Konsens gibt, daran etwas zu ändern. Es gibt die Bedrohung durch Umweltprobleme, Klimaveränderungen, Kriege quasi vor der eigenen Haustür, gesellschaftliche und politische Veränderungen, wachsende Ungleichheit und die Ausweitung der Einkommensschere.
Der Einzelne kann hier kaum nennenswerten Einfluss auf Entwicklungen nehmen. Versuche auf internationaler Ebene, Vereinbarung zur Verbesserung der Situation in Klimafragen, politischen Diskussionen oder Friedensverhandlungen zu erreichen, scheitern immer wieder. Dies lässt uns unserer Machtlosigkeit und der Überforderung bewusst werden. Da gibt es dann oftmals eine kleine Minderheit, die sich gegen Krieg, für Menschenrechte, gegen Umweltverschmutzung, für den Schutz der Meere, gegen Ausbeutung und Kinderarbeit und gegen den Welthunger einsetzt. Und dann gibt es die große Mehrheit, die mit Interessenlosigkeit und wachsender politischer Apathie wegschaut und sich weiter um sich selbst dreht. Viele von ihnen nicht, weil sie nicht empathisch sind oder den Status Quo in Sachen Umwelt, Hunger, Krieg und Ungerechtigkeit nicht erkennen, sondern weil sie sich ohnmächtig und überfordert fühlen, obwohl sie sich der Konsequenzen ihres Nichtstuns bewusst sind.
Die Krise der sozialen Sicherungssysteme
Und dann gibt es da noch einen vierten Bereich in dem wir als Gesellschaft mit Überforderung konfrontiert sind und der Einzelne ebenfalls Ohnmacht verspürt, weil er kaum Möglichkeit hat etwas systemisch zu verändern. Ich spreche von dem drohenden Kollaps unserer sozialen Absicherung und der Gefahr der Zerstörung unserer demokratischen und sozialen Gesellschaftsordnung.
Bereits im Jahre 1986, als Norbert Blüm proklamierte „Die Rente ist sicher“, war aufgrund der demographischen Entwicklung abzusehen, dass das System ohne eine grundlegende Reform eines Tages zusammenbrechen wird. Erstaunlich, dass der Ausspruch von Blüm bis heute, fast 40 Jahre danach, Bestand hatte. Aber selbst die Änderungen, die in den vergangenen 40 Jahren am Rentensystem durchgeführt wurden, haben nicht zu einer Gesundung des Systems geführt. Es war und ist bis heute Flickschusterei. Und da stehen wir in Europa und der Welt nicht alleine da. Viele Länder haben das gleiche Problem, dass die Generationen vor uns auf Kosten der Jungen lebten, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Berücksichtigung von erkennbaren demographisch bedingten bevorstehenden massiven Problemen.
Das gleiche gilt für das System der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung und der Verwaltung einer Heerschar von Arbeitslosen, die in den kommenden Jahren voraussichtlich aufgrund der Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz dramatisch ansteigen wird. Dafür spricht nicht nur die wirtschaftliche Situation in Deutschland und ein sich immer deutlich abzeichnende Weltwirtschaftskrise, sondern auch die quasi wöchentlich sich überschlagenden Meldungen über Fortschritte und neue Anwendungsmöglichkeiten von KI.
Ist künstliche Intelligenz Fluch oder Segen?
Es gibt viele Stimmen, die einer Zukunft, in der KI eine zentrale Rolle in unserem gesellschaftlichen und Arbeitsleben spielt, positiv entgegensehen. Die Rede ist von niemals zuvor gesehenen Produktionszuwächsen, Wohlstand für alle und dem Wegfall der Notwendigkeit für sein tägliches Brot arbeiten zu gehen. Andere sehen primär die Gefahr, die KI selbst für uns darstellen könnte, wenn sie die Kontrolle übernimmt. Oder die Gefahr, die von Menschen ausgeht, die KI als Instrument für politische, kriegerische und verbrecherische Ziele einsetzen.
Wie auch immer man zur KI steht, wir gehen einer Zeit von dramatischen Umwälzungen entgegen. Die Gefahren, die von den Warnern aufgeführt werden sind real. Inwieweit sie Wirklichkeit werden, kann man nur bedingt sagen. Dass einige davon wie politische Einflussnahme, Entwicklung von autonomen Waffen oder Einsatz von KI für Phishing-Aktionen schon heute Realität sind, lässt Schlimmes für die Zukunft befürchten. Dass KI eine dramatische Akzeleration der Entwicklungen und Veränderungen bewirkt, führt bei vielen auch zu einer Art Ohnmachtsempfinden, weil man merkt, dass man mit der Geschwindigkeit in der sich unsere Umwelt verändert immer weniger Schritt halten kann.
Viele Parameter, die unser tägliches Leben bestimmen, verändern sich oder sind plötzlich nicht mehr relevant. Viele Stellschrauben, die wir früher selber nutzen konnten, um unser Leben zu „regeln“, werden automatisiert. Bekannte Wege, Schritte, Umgebungen verändern sich und wir müssen uns anpassen. Das war schon immer so: Neue Erfindungen machten andere Dinge obsolet. Neue Ideen haben andere verdrängt. Neue Konzepte haben sich als besser oder erfolgreicher als Althergebrachtes herausgestellt und so wurde „Altes“ verschrottet und Neues etabliert. Die Entwicklung ist die gleiche heute. Doch das Tempo ist ein anderes. Uns bleibt immer weniger Zeit uns an neue Gegebenheiten anzupassen. Und die Geschwindigkeit, in der Veränderungen auf uns zukommen, wächst täglich und mit dem Einsatz von KI vermutlich in einzelnen Bereichen exponentiell.
Systemversagen und politische Lähmung
Die weitere Zuspitzung der finanziellen Probleme unsere sozialen Netze ist absehbar. Ein Crash der Systeme ohne heftige Einschnitte und Umgestaltung durch den Gesetzgeber ist vorprogrammiert. Sollte die Politik diese Probleme in nächster Zeit endlich ernsthaft angehen, so wird es zu großem Leid bei denen kommen, die ohnehin nicht viel haben. Und zu erheblichem Widerstand bei denen, die mehr haben und deren Habe oder Einkommen zu größeren Teilen umverteilt werden müsste.
Dass sich die Politik in den vergangenen Jahren als unfähig oder unwillig gezeigt hat, ist nicht nur ein Zeichen der individuellen Überforderung der Verantwortlichen, sondern auch ein Zeichen dafür, dass unser demokratisches System hier an seine Grenzen kommt. Für einen deutlichen Einschnitt und eine Gesundung unserer sozialen Netze, bräuchten wir entweder einen überparteilichen und mehrheitsfähigen Konsens in der politischen Parteilandschaft und der Gesellschaft oder eine politische Macht, die die Veränderungen ohne Rücksicht auf Verluste durchdrückt. Beides ist in unserer derzeitigen politischen Lage unwahrscheinlich, wenn nicht gar unmöglich.
Es gibt zu viele Interessengruppen und Lager, die ihre Pfründe verteidigen und viel zu viele Politiker, denen das persönliche Wohl und die Wiederwahl wichtiger sind als echte Veränderungen hin zu einer gerechteren und besseren Welt für alle. Fehlende echte Alternativen in der politischen Landschaft, fehlende Führungsfiguren in den etablierten politischen Parteien, zunehmende Radikalisierung von größeren Gesellschaftsteilen, sowie die internationale wirtschaftliche und politische Verflechtung einhergehend mit größerer Einfluss von totalitären Strukturen im Ausland machen die Gesamtgemengelage unübersichtlich.
Aufgrund der Versäumnisse von Jahrzehnten ist die Überforderung unserer Regierung von Jahr zu Jahr immer größer geworden. Die Konzentration auf ein einzelnes Problem und dessen Beseitigung wird immer schwieriger, weil es immer mehr drängende Bereiche gibt, in denen ein Eingreifen oder eine Lösungsfindung dringend und möglichst zeitnah nötig wird. Das führt zu immer mehr Flickschusterei und zu Aktionismus anstatt zu handhabbaren langfristigen Lösungsansätzen.
Der Preis der Überforderung
Der volkswirtschaftliche Schaden durch psychische Erkrankungen und Burn-out geht in die Milliarden. Abgesehen von den menschlichen Einzelschicksalen, die sich dahinter verbergen, stellt sich die Frage: Wann wird es zu teuer? Wann müssen wir gegenlenken? Und wer ist hier gefordert und was kann man tun?
Grundsätzlich gibt es ein positives und ein negatives Szenario, wie sich die Frage der Überforderung in den kommenden Jahren entwickeln könnte. Während die Einen eine Entspannung der Lage und eine gesellschaftsweite Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse durch Produktivitätszuwachs und Entlastung der arbeitenden Bevölkerung durch den Einsatz von Technik, insbesondere KI und Roboter, erwarten, befürchten Andere, dass die Geschwindigkeit des Wandels die Systeme sprengt, die Ungleichheit verstärkt und die psychische Belastung durch Informationsflut und stetigen Wandel verstärkt. Im zweiten Fall führt die zunehmende Automatisierung zu einer stärkeren Belastung der sozialen Systeme, da sie mit erheblichem Abbau von Arbeitsplätzen einhergehen würde. Das führt zu Beitragseinbußen und in der Folge zu noch größeren Finanzierungslücken der sozialen Netze. Leistungen der Arbeits-, Kranken-, Renten und Pflegeversicherung sind damit in bisherigem Umfang nicht mehr zu stemmen.
Wege aus der Krise
Angesichts dieser zwei unterschiedlichen Wege, die die Szenarien aufzeigen, brauchen eine politische Landschaft, die mit Voraussicht und Fingerspitzengefühl Änderungen und Einschnitte durchführt, um die Systeme neu aufzustellen. Neben fiskalpolitischen und institutionellen Reformen, die vor allem Bürokratismus, Missbrauch und Verschwendung von Mitteln abbauen, brauchen wir auch einen Abbau von verkrusteten Strukturen und mehr Flexibilität im Arbeitsalltag. Dies betrifft auch Regelungen des Arbeitnehmerschutzes, die schnellere Anpassungen an Marktgegebenheiten ermöglichen, ohne den Arbeitnehmerschutz auszuhebeln.
Die rasante technische Entwicklung wird Unternehmen zu raschen Anpassungen zwingen, auch um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Die Einführung von KI und Robotik in weite Teile der Wirtschaft wird in den kommenden Jahren zu erheblichem Abbau von Arbeitsplätzen führen. Auch wenn von vielen Seiten der Einwand kommt, dass KI die Mitarbeiter nicht ersetzen wird, sondern nur die Tätigkeit an sich verändern und von Routinearbeiten entlasten wird, so muss man doch sehen, dass auch eine teilweise Entlastung im Endeffekt den Wegfall von menschlicher Arbeit bedeutet. Das war schon so zu Zeiten der industriellen Revolution, das war so bei der Einführung des Computers in die Arbeitswelt und so wird es auch jetzt wieder sein. Es wird weniger „Arbeit für Menschen“ zu verteilen geben. Neue Arbeitszeit- und Entgeltmodelle müssen ausprobiert werden.
Die Tatsache, dass man den Unternehmen mehr Freiheiten gibt, um ihr Geschäft den veränderten Marktgegebenheiten schnellstmöglich anzupassen, bedeutet aber nicht, dass man unser System der sozialen Marktwirtschaft über Bord wirft und die arbeitende Bevölkerung sich selbst und der Willkür der Unternehmer überlässt. Ganz im Gegenteil. Damit ein Umbau der sozialen Netze und die zukünftige Finanzierung gelingt, ist es notwendig Unternehmen stärker als bisher in die soziale Verantwortung zu nehmen. Mögliche Produktivitätszuwächse und Gewinne, die durch den Einsatz von KI und Robotern erwirtschaftet werden, müssen gesellschaftlich gerechter aufgeteilt werden.
In einem ersten Schritt müsste ein Teil dieses Geldes dazu verwendet werden, die Sozialversicherung besser und langfristig zu finanzieren. Sollten sich im Laufe der Jahre Szenarien bewahrheiten, dass große Teile der Bevölkerung nicht mehr für die Arbeitsleistung benötigt werden, weil diese von KI und Robotern übernommen wird, so muss auch eine Umverteilung der Gewinne im Sinne eines universellen, bedingungslosen Grundeinkommens geschaffen werden. Ein Grundeinkommen, das nicht nur das Existenzminimum sichert, sondern auch eine gerechtere Verteilung der Gesamtleistung sichert.
Geschieht dies nicht, oder nicht schnell genug, oder nicht in ausreichendem Maße, so ist mit einer weiteren Radikalisierung von größeren Bevölkerungsgruppen zu rechnen. Es wird nicht nur zu Streiks und Demonstrationen kommen, sondern auch zu drastischeren Ausschreitungen, Sabotage und Anschlägen. Da ähnliche Entwicklungen in vielen anderen Ländern zu erwarten sind, ist davon auszugehen, dass solche Reaktionen der Revolte ausgehend von einem Land ähnliche Reaktionen in anderen Ländern auslösen würden.
Bleibt die Frage: Wie können wir als Individuen und als Gesellschaft der Überforderung begegnen? Als Individuen in der Arbeitswelt müssen wir darauf hoffen, dass wir auch weiterhin einen Wert für den Arbeitsmarkt darstellen. Ich formuliere es bewusst so neutral. Ein Arbeitgeber, der im Mitarbeiter keinen Wert mehr erkennt, hat keine Veranlassung ihn weiter zu beschäftigen. Um unseren Wert in einem sich permanent und schnell wandelnden Arbeitsmarkt zu behalten, müssen wir uns anpassen. Anpassung an neue Arbeitsumgebung, neue Arbeitsmodelle, neue Herausforderungen durch Technik oder Marktveränderungen. Dies bedeutet kontinuierliches Lernen, Offenheit gegenüber Veränderungen und bewusstes Nachdenken darüber, wie ich den Wert, den ich einbringe, erhalten oder steigern kann. Flexibilität in Bezug auf neue Chancen und berufliche Veränderungen wird einer der Schlüsselfaktoren sein, um langfristig erfolgreich Beschäftigung zu finden. Der Job auf Lebenszeit in nur einem einzigen Unternehmen ist vermutlich in Zukunft eine Utopie.
Fokus auf mentale und körperliche Gesundheit im Alltag
Im privaten Bereich können wir der Überforderung begegnen indem wir mehr auf unsere Mentale und körperliche Gesundheit achten. Dazu gehören Dinge, die im Prinzip allen bekannt und bewusst sind, aber bei vielen einfach zu wenig Beachtung finden. Dinge wie gesundes Essen, viel Bewegung, Auszeiten und Pausen, echte soziale Kontakte, Hobbies und alles, was uns persönlich einen Weg der Entspannung und des Loslassens vom stressigen Alltag bietet. Wir alle wissen eigentlich intuitiv was gut für uns ist uns können es in unzähligen Ratgebern und Zeitschriften tagtäglich lesen. Allein an der kontinuierlichen Umsetzung hapert es bei den meisten. An dieser Stelle kann ein wenig mehr Selbstdisziplin im Sinne der eigenen Gesundheit wirklich helfen Gefühle der Ohnmacht und der Überforderung zu reduzieren und das Leben lebenswerter und unbeschwerter zu machen.
Heutzutage finden immer weniger Menschen Halt im kirchlichen Umfeld. Stattdessen suchen sie Orientierung bei Life-Coaches oder bei ChatGPT. Hier muss nicht nur die Kirche sich überlegen wie sie dem entgegentritt. Auch auf politischer Ebene ist es wichtig Wege zu finden, damit diese Orientierungslosigkeit nicht in politischen Extremismus, mehr Egoismus und Radikalismus mündet. Kirche, Staat und gesellschaftlich relevante Gruppen müssen wieder Führungsaufgaben hin zu einem gesünderen Miteinander übernehmen und Orientierungshilfen anbieten, die nicht leere Versprechen, sondern Handlungen und relevante Ergebnisse beinhalten.
Medienkompetenz und Achtsamkeit im Umgang mit digitalen Medien
Ein weiterer und in der heutigen Zeit besonders wichtiger Punkt zur Reduzierung von Stress ist digitale Medienkompetenz. Wir müssen lernen verantwortungsvoller und aufmerksamer mit digitalen Medien umzugehen. Unsere durchschnittliche Verweildauer vor Bildschirmen steigt von Jahr zu Jahr. Binge-scrolling, binge-watching und dauerhaftes Checken von Social Media Plattformen oder Emails sind die neuen gesellschaftlich geduldeten Suchtkrankheiten unserer modernen Zeit. Algorithmisch verstärkte und verursachte Suchtmuster und Filterblasen werden erkannt aber nicht aktiv bekämpft. Es gibt zwar Warnrufe von Wissenschaftlern, Medizinern und Suchtbetreuern aber da dieses Suchtverhalten keinen direkt sichtbaren Schaden für Dritte verursacht, wird es gesellschaftlich toleriert.
Wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt, im Restaurant, im Bus oder in einer größeren Menschengruppe ist es wirklich erschreckend anzusehen, wie sehr wir inzwischen von unseren Tablets und Smartphones vereinnahmt werden. Digitale Kompetenz zeigt sich in erster Linie in einem bewussteren Umgang mit diesen Medien. Wir müssen unser Suchtverhalten ständig online sein zu müssen in den Griff bekommen. Das bedeutet in einem ersten Schritt sich bewusst zu werden, wie viel Zeit wir vor Bildschirmen verbringen und was wir da eigentlich machen. Zu diesem Zweck helfen Apps, die unser Verhalten tracken, die Verweildauern festhalten, die Anzahl der Zugriffe veranschaulichen, oder sie auch begrenzen können. Andere Apps können uns auffordern einen Moment inne zu halten und nochmal bewusst die Entscheidung treffen, ob die Nutzung einer App in diesem Moment relevant ist oder es nur ein unbewusstes Suchtverhalten ist, dass durch irgendeinen Impuls getriggert wird.
Digitale Medienkompetenz bedeutet auch, dass wir neben der kritischen Betrachtung unseres Nutzerverhaltens auch die Inhalte kritischer anschauen. Wir müssen uns bewusster werden, womit wir unsere Zeit verbringen und ob die Inhalte, die wir auf sozialen Plattformen konsumieren wirklich relevant und gut für uns sind. Angesichts von zunehmend künstlich erstellten oder durch Filter veränderten Inhalten, angesichts von oberflächlichen propagierten Werten und Schönheitsidealen, Hass, Gewalt, politischer Einflussnahme und offensichtlich erkennbaren wirtschaftlichen Interessen vieler Beteiligter müssen wir uns fragen, was davon für uns von echtem Interesse ist, was davon einen wirklichen Mehrwert für uns hat, was davon versucht uns in eine Richtung zu beeinflussen, die sich wirtschaftlich, mental, kulturell oder politisch negativ auswirkt.
Durch strickte zeitlich Begrenzung der Nutzung von digitalen Medien und bewusstere Auswahl der Inhalte, die wir konsumieren, können wir die Flut an Informationen kanalisieren und auf ein „erträgliches Maß“ reduzieren. Dadurch entlasten wir unseren Geist und verhindern mentale Vermüllung und Überforderung.
Zu guter Letzt bleibt die Frage, was wir als Gesellschaft gegen die zunehmende Überforderung der Menschen unternehmen sollten. Unbestritten ist sicherlich, dass wir angesichts zunehmender psychischer Erkrankungen nicht nur präventiv im Arbeitsalltag und im Privatleben Vorsorge treffen müssen. Besonders wichtig ist, dass Betroffene schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen. Dazu bedarf es nicht nur eines zügigen Ausbaus der psychischen Gesundheitseinrichtungen und eines gesellschaftsweiten Diskurses zur niedrigschwelligen Prävention, sondern auch zur Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders in Gruppen, Vereinen, Familien und Freundeskreisen. Wir müssen das menschliche Miteinander, den persönlichen Kontakt und das Schaffen von gemeinsamen Werten und Erinnerungen stärker fördern.
Außerdem ist es ungeheuer wichtig, das Bildung und Fortbildung in dieser schnelllebigen Zeit gefördert und demokratisiert werden. Bildung muss kostenlos zur Verfügung gestellt werden und der Zugang muss allen Gesellschaftsschichten gleichermaßen ermöglicht werden. Bildung darf kein Privileg sein und da, wo die Familien versagen, muss es andere geben, die sich verantwortlich zeigen jungen Menschen die notwendige Starthilfe ins Leben zu geben.
Sollte künstliche Intelligenz in naher Zukunft wirklich auf breiter Front zur Freistellung von hunderttausenden Beschäftigten führen, so wird eine der wichtigsten Aufgaben sein die Demokratisierung des Zugriffs auf KI zu gewährleisten und den Menschen Wege zu ebnen neue sinnstiftende und erfüllende Aufgaben zu finden. In Zukunft wird nicht Arbeit der Schlüssel für ein wertvolles und sinnreiches Leben sein, sondern die Fähigkeit sich eine anspruchsvolle Aufgabe selber zu suchen, unabhängig von Einkommen und Status. In Zukunft wird nicht Wissen der Schlüssel zu Erfolg und Wohlstand sein, sondern die Verarbeitung und Anwendung all des angehäuften Wissens.
Das könnte dich auch interessieren

Wir brauchen den Crash der KI-Blase
15. November 2025
Positive Visionen entwickeln für eine inklusive technologische Zukunft
11. November 2025